Wenn du ein eigenes Business starten möchtest, triffst du früher oder später auf das Thema Unternehmensformen. Denn jede Gründung in Deutschland benötigt eine passende Rechtsform. Doch welche Form passt am besten zu deiner Geschäftsidee, deinen finanziellen Möglichkeiten und deinen persönlichen Vorstellungen? In diesem Artikel erhältst du eine umfassende Übersicht zu den gängigen Unternehmensformen in Deutschland, deren Vor- und Nachteile und worauf du achten solltest, wenn du dich entscheidest. So hast du eine solide Grundlage, um mit deinem Unternehmen erfolgreich durchzustarten.

Die Unternehmensform ist die rechtliche Grundlage deines Geschäfts. Sie entscheidet nicht nur über deine persönliche Haftung, sondern auch über steuerliche Aspekte, Kapitalbedarfe, formale Anforderungen und den Außenauftritt. Eine falsche Wahl kann später viel Zeit, Geld und Nerven kosten. Deshalb ist es sinnvoll, sich bereits vor der Gründung ausführlich mit den Unternehmensformen einfach erklärt auseinanderzusetzen. Darüber hinaus beeinflusst die Rechtsform beispielsweise folgende Punkte:
In Deutschland existiert eine große Vielfalt an Unternehmensformen. Häufig steht man vor der Frage: Einzelunternehmen, Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) oder doch lieber die kleine Schwester, die UG (haftungsbeschränkt)? Um dir die Entscheidung zu erleichtern, bekommst du im Folgenden eine umfassende Unternehmensformen Übersicht.
Das Einzelunternehmen ist in Deutschland mit Abstand die häufigste Rechtsform. Du kannst es gründen, sobald du eine gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit aufnimmst, ohne einen weiteren Gesellschafter zu haben. Es ist die erste Wahl für viele, die sich allein selbstständig machen möchten – zum Beispiel als Dienstleister, Handwerker oder Online-Händler. Einzelunternehmer benötigen kein Startkapital und können rasch loslegen.
Diese Form ist also bestens geeignet, wenn du schnell und unkompliziert starten willst. Wenn dein Geschäft allerdings stark wächst oder du Investoren anziehen möchtest, kann ein Wechsel in eine andere Rechtsform sinnvoll sein.
Die GbR ist die einfachste Form der Personengesellschaft und wird immer dann gegründet, wenn sich mindestens zwei Personen zur gemeinsamen Verfolgung eines Zwecks zusammenschließen. Genau wie das Einzelunternehmen erfordert die GbR keine Eintragung ins Handelsregister, solange sie nicht zu groß wird. Eine offizielle Gründungsformalia über einen Notar ist nicht zwingend nötig, dennoch empfiehlt sich ein schriftlicher Gesellschaftsvertrag, um alle wichtigen Punkte wie Gewinnverteilung, Stimmrechte oder Ausscheidung eines Gesellschafters festzuhalten.
Sobald du mit einem Partner zusammenarbeitest und klar wird, dass ihr eine gemeinsame Gewinnerzielungsabsicht verfolgt, ist eine GbR schnell gegründet. Für den ersten Schritt, beispielsweise bei einem kleinen Onlineshop oder einem Agenturbetrieb, reicht das häufig aus. Möchtet ihr später expandieren, bietet sich ein Wechsel in eine Kapitalgesellschaft an.
Die OHG ist eine Handelsgesellschaft, die entsteht, wenn zwei oder mehr Personen gemeinsam ein Handelsgewerbe betreiben. Voraussetzung ist die Eintragung ins Handelsregister. Damit erhält die Gesellschaft auch nach außen hin eine höhere Verbindlichkeit und kann als seriösere Alternative zur GbR wahrgenommen werden. Allerdings ist auch bei der OHG die Haftung nicht beschränkt, alle Gesellschafter haften voll.
Wenn du gemeinsam mit Geschäftspartnern ein Handelsgewerbe gründest, kann die OHG sinnvoll sein, sofern euch die unbeschränkte Haftung bewusst ist. Andernfalls ist eine Kapitalgesellschaft oder eine Kommanditgesellschaft (KG) eine Alternative.
Die KG ist eine Personengesellschaft, bei der es zwei Arten von Gesellschaftern gibt: Komplementäre und Kommanditisten. Die Komplementäre haften unbeschränkt, während die Kommanditisten nur mit ihrer Einlage haften. Das sorgt für eine gewisse Risikominimierung für jene, die sich finanziell beteiligen, aber nicht in der Geschäftsführung aktiv werden möchten.
Die KG eignet sich oft für Familienunternehmen oder Projekte, bei denen Investoren Kapital einbringen, aber im Tagesgeschäft nicht mitreden wollen. Allerdings bleibt das Haftungsrisiko für die Komplementäre hoch.
Die GmbH ist mit Abstand die beliebteste Kapitalgesellschaft in Deutschland. Bei dieser Rechtsform haftet nur die Gesellschaft mit ihrem Geschäftsvermögen. Deine private Haftung bleibt davon getrennt, sofern du als Gesellschafter keine grob fahrlässigen Handlungen vornimmst. Um eine GmbH zu gründen, brauchst du mindestens 25.000 Euro Stammkapital (wobei die Hälfte zu Beginn eingezahlt sein muss). Ein Gesellschaftsvertrag und ein Notartermin sind obligatorisch.
Die GmbH kann auch von einer einzigen Person als sogenannte Ein-Personen-GmbH gegründet werden. Sie eignet sich insbesondere für Geschäftsideen mit höherem Risiko oder Kapitalbedarf. Durch ihre Professionalität und Begrenzung der Haftung schafft sie Vertrauen bei Kunden und Geschäftspartnern.
Die UG (haftungsbeschränkt) – auch Mini-GmbH oder 1-Euro-GmbH genannt – ist eine spezielle Form der GmbH. Sie wurde eingeführt, um Gründern einen leichteren Zugang zur beschränkten Haftung zu ermöglichen. Theoretisch kannst du sie mit nur einem Euro Stammkapital gründen, allerdings sind in der Praxis etwas höhere Beträge sinnvoll, um die anfänglichen Kosten zu decken.
Die UG kann ein sinnvoller Kompromiss sein, wenn du zwar die Vorteile einer Kapitalgesellschaft möchtest, aber das Stammkapital für eine klassische GmbH nicht aufbringen kannst. Sie ist besonders verbreitet bei Start-ups und jungen Unternehmen mit begrenztem Budget.
Die GmbH & Co. KG verbindet die Vorteile einer Kommanditgesellschaft mit denen der GmbH. Hier ist die GmbH der Komplementär, der normalerweise unbeschränkt haften würde. Da aber eine GmbH nur mit ihrem Gesellschaftsvermögen haftet, ist das Risiko wiederum beschränkt. Die Kommanditisten haften wie in jeder KG nur mit ihrer Einlage.
Die GmbH & Co. KG ist bei mittelständischen Unternehmen und Familienbetrieben beliebt, die von der Personengesellschaft-Struktur profitieren möchten und gleichzeitig die Haftung beschränken wollen. Allerdings ist diese Konstruktion recht beratungsintensiv und aufwendiger in der Buchführung.
Die AG ist eine Kapitalgesellschaft mit weitgehender Trennung zwischen Eigentum und Geschäftsführung. Aktionäre (Aktionärskreis) bringen das Grundkapital auf und teilen sich in Aktien auf. Die Geschäftsleitung erfolgt durch den Vorstand, der von einem Aufsichtsrat kontrolliert wird. Um eine AG zu gründen, benötigst du ein Mindestgrundkapital von 50.000 Euro. Die AG ist besonders interessant, wenn du großes Wachstum und vielleicht sogar einen Börsengang anstrebst.
Die AG lohnt sich vor allem für größere Firmen, die mit größeren Investitionssummen arbeiten und perspektivisch viele Gesellschafter haben oder an die Börse gehen wollen. Für ein kleines Startup oder ein Nebengewerbe ist diese Form in der Regel überdimensioniert.

Neben den genannten Hauptformen existieren noch weitere Varianten, die in speziellen Fällen zum Einsatz kommen, zum Beispiel die eingetragene Genossenschaft (eG) oder die Partnerschaftsgesellschaft (PartG) für Freiberufler. Auch Sonderformen wie Stiftungen oder Vereine zählen rechtlich als mögliche Organisationsformen, die aber oft einen ganz anderen Zweck verfolgen. Damit du den Überblick behältst, kommt hier eine kompakte Unternehmensformen Tabelle, in der du die wichtigsten Fakten auf einen Blick siehst.
| Rechtsform | Haftung | Mindestkapital | Buchführung | Gründungskosten |
|---|---|---|---|---|
| Einzelunternehmen | Unbeschränkt (Privatvermögen) | Kein | EÜR (meist) | Niedrig (Gewerbeanmeldung) |
| GbR | Unbeschränkt, alle Gesellschafter | Kein | EÜR (sofern Kleingewerbe) | Sehr gering |
| OHG | Unbeschränkt, alle Gesellschafter | Kein | Kaufmännische Buchführung | Mittel (Notar & Handelsregister) |
| KG | Komplementär unbeschränkt, Kommanditist beschränkt | Kein (nur Einlage Kommanditist) | Kaufmännische Buchführung | Mittel (Notar & Handelsregister) |
| GmbH | Haftung beschränkt auf Gesellschaftsvermögen | 25.000 € (mind. 12.500 € anfangs) | Doppelte Buchführung, Jahresabschluss | Höher (Notar, HR-Eintrag, Stammkapital) |
| UG (haftungsbeschränkt) | Haftung beschränkt auf Gesellschaftsvermögen | 1 € (theoretisch) | Doppelte Buchführung, Jahresabschluss | Mittel (Notar, HR-Eintrag) |
| GmbH & Co. KG | GmbH als Komplementär beschränkt | 25.000 € in der GmbH | Doppelte Buchführung, Jahresabschluss | Hoch (zweifache Gründung: GmbH + KG) |
| AG | Haftung beschränkt auf Gesellschaftsvermögen | 50.000 € | Doppelte Buchführung, großer Jahresabschluss | Sehr hoch (Notar, HR-Eintrag, Grundkapital) |
Die hier gezeigte Unternehmensformen Tabelle liefert dir einen ersten Eindruck, aber jede Gründung ist einzigartig. Bevor du dich festlegst, solltest du daher folgende Fragen beantworten:
Letztlich solltest du nicht nur an die Gründung denken, sondern auch an die langfristige Unternehmensentwicklung. Es ist in Deutschland zwar möglich, die Rechtsform zu wechseln, doch dieser Schritt verursacht erneut Kosten und administrativen Aufwand. Ein gründlicher Blick auf die Unternehmensformen Vor- und Nachteile beugt teuren Fehlentscheidungen vor.
Das hängt von deiner Geschäftsidee, deinem Risikoprofil und deiner finanziellen Situation ab. Wenn du alleine gründest und nur wenig Kapital hast, ist ein Einzelunternehmen (bzw. eine UG) oft der einfachste Weg. Planst du hingegen größere Projekte, ist eine Kapitalgesellschaft sinnvoller. Eine kurze Beratung durch einen Steuerberater oder Gründungsberater kann viel Klarheit schaffen.
Ja, ein Wechsel der Rechtsform ist möglich. Beispielsweise könntest du von einer GbR in eine GmbH wechseln, sobald dein Unternehmen wächst. Beachte jedoch, dass bei solchen Umwandlungen erneut Notarkosten, Gebühren fürs Handelsregister und unter Umständen Steuern anfallen können.
Nicht unbedingt. Eine beschränkte Haftung bietet zwar finanziellen Schutz, erfordert jedoch mehr bürokratischen Aufwand und finanzielle Mittel (z.B. Stammkapital). Für risikoarme Tätigkeiten kann ein Einzelunternehmen vollkommen ausreichend sein. Umgekehrt ist bei riskanten oder kapitalintensiven Projekten die beschränkte Haftung oft ein Muss, um das Privatvermögen zu schützen.
Bei den Personengesellschaften dominieren Einzelunternehmen und GbRs, da sie sehr einfach und kostengünstig zu gründen sind. Bei den Kapitalgesellschaften ist die GmbH die Nummer eins, gefolgt von der UG, die wegen ihres geringen Mindestkapitals besonders bei Start-ups beliebt ist.
Freiberufler gelten nicht als Gewerbetreibende. Sie brauchen daher keine klassische Unternehmensform, sondern melden ihre Tätigkeit direkt beim Finanzamt an. Beispiele sind Ärzte, Anwälte, Designer, Journalisten oder Berater. Allerdings kann sich für bestimmte Zwecke (z.B. Zusammenarbeit in einer Partnerschaftsgesellschaft) eine separate Rechtsform lohnen.
Kapitalgesellschaften unterliegen der Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer. Dafür liegt der Steuersatz für Körperschaftsteuer fest bei 15 % (zzgl. Solidaritätszuschlag), während Einzelunternehmen und Personengesellschaften mit ihrem Gewinn der Einkommensteuer (progressiver Satz) unterworfen sind. Ob das günstiger oder teurer ist, hängt vom konkreten Gewinn und weiteren Faktoren ab. In jedem Fall lohnt es sich, die Steuerbelastung vorab zu kalkulieren.
Die UG (haftungsbeschränkt) wird gerne als „kleine GmbH“ bezeichnet und erlaubt einen minimalen Kapitaleinsatz. Zwar kann das anfangs kritisch beäugt werden, doch für Gründer mit kleinem Budget ist sie eine legitime Möglichkeit, eine beschränkte Haftung zu erlangen. Wichtig ist nur, dass du jährlich 25 % des Gewinns in Rücklagen steckst, bis das Stammkapital einer GmbH (25.000 Euro) erreicht ist. Dann kannst du zur GmbH aufsteigen.
Es gibt viele Anlaufstellen: Industrie- und Handelskammern (IHK), Handwerkskammern, Gründerzentren, Steuerberater, Rechtsanwälte oder spezielle Gründerportale. Sie bieten dir ausführliche Informationen zu Unternehmensformen Deutschland, finanzielle Fördermöglichkeiten oder beraten dich individuell bei deiner Entscheidung.
Ob Einzelunternehmen, GmbH, UG oder eine andere Gesellschaftsform – die Hauptsache ist, dass du deine Rahmenbedingungen kennst und deine Wahl bewusst triffst. Entscheidend ist, wie viel Verantwortung und Risiko du tragen willst, wie du dich finanzieren möchtest und welchen Eindruck du am Markt hinterlässt. Mit einer bedachten Planung und einer gründlichen Beschäftigung mit den Unternehmensformen Vor- und Nachteile legst du das Fundament für dein erfolgreiches Business.
Und wenn du jetzt wissen möchtest, wie du darüber hinaus als kompletter Einsteiger im Online-Bereich zwischen 3.000 und 21.000 Euro im Monat verdienen kannst, wirf doch einen Blick auf die kostenlose Video-Präsentation auf Digitalbewerben.com. Dort erfährst du Schritt für Schritt, wie du als Partner von Digitalbewerben.com ein lukratives Einkommen aufbauen kannst – unabhängig davon, für welche Unternehmensform du dich entscheidest.
WEITERE ARTIKEL
Weitere Services
Rechtliches
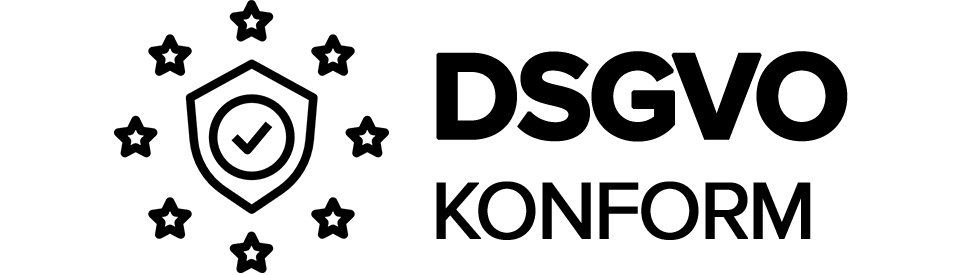
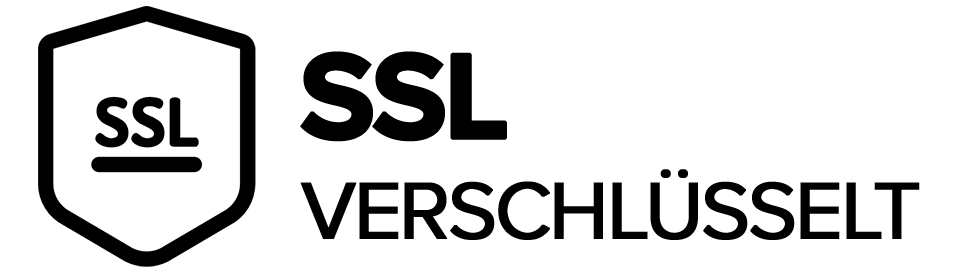
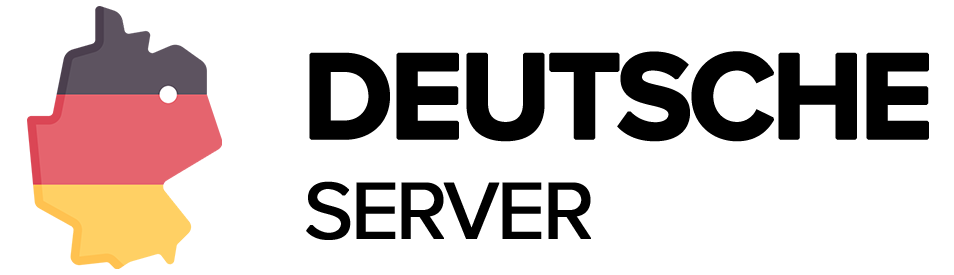
© Digitalbewerben.com